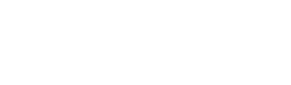In der Natur gibt es immer wieder kleine Überraschungen – und Schnecken machen da keine Ausnahme! Die meisten Schneckenhäuser sind nach rechts gewunden. Doch manchmal taucht unter Tausenden dieser Rechtsdreher ein Außenseiter auf: eine Schnecke, deren Haus sich nach links windet. Bei der Weinbergschnecke (Helix pomatia) nennt man ein solches nach links gewundenes Exemplar aufgrund ihrer Seltenheit auch „Schneckenkönig“. Schon seit der Renaissance wecken diese seltenen Exemplare das Interesse von Sammlern und Forschern. Hinter diesem kuriosen Phänomen steckt ein spannendes mathematisches und biologisches Prinzip! Bei unserem Exponat Schneckenkönig kommt diese Seltenheit besonders zum Ausdruck. Unter 304 fast identisch aussehenden Schneckenhäusern befindet sich genau ein nach links gewundenes. Kannst du es finden?

Und nun … die Mathematik
In den meisten Schneckenfamilien ist die Windungsrichtung innerhalb einer Art festgelegt und dient sogar als Bestimmungsmerkmal. So sind z. B. fast alle Weinbergschnecken rechts gewunden. Nur etwa eines von mehreren Zehntausend ist links gewunden, der sagenumwobene Schneckenkönig. Doch warum ist sind sie so selten?

Ein Schneckenkönig ist eine extrem seltene Ausnahme. Mathematisch betrachtet ist dies eine spiegelbildliche Variante der üblichen Gehäusespirale. Da eine Schneckenschale keine Symmetrieebene besitzt, kann man ein Bild davon nicht einfach spiegeln, ohne dabei eine völlig andere Windungsrichtung darzustellen. Wir haven hier also ein anschauliches Beispiel für das Prinzip der Chiralität vorliegen, das wir auch von der Händigkeit (links- und rechtshändig) und von Molekülformen aus der Chemie kennen. Außer eines linksgewundenen Schneckenhauses liegen außerdem alle inneren Organe der Schnecke auf der jeweils anderen Seite. Da sich zum Beispiel die Geschlechtsorgane der Weinbergschnecken nur auf einer Seite befinden, ist die Paarung einer links- und rechtsgewundenen Schnecke also fast unmöglich.
Selbst wenn eine Paarung geklappt hat, ist noch nicht klar, wie das dafür verantwortliche Gen vererbt wird. Zunächst könnte man meinen, es handle sich dabei um einen ganz normalen dominant-rezessiven Erbgang nach Mendel. Rechts wäre dominant, links rezessiv. Doch Kreuzungsexperimente zeigen: Diese einfache Vererbung erklärt die äußerst geringe Zahl links gewundener Schnecken nicht. Vielmehr kann es passieren, dass eine rechts gewundene Schnecke plötzlich nur noch links gewundene Nachkommen hat und umgekehrt.
Bereits 1923 konnte der amerikanische Genetiker Alfred Henry Sturtevant dieses Rätsel anhand der Schlammschnecke Radix labiata lösen. Tatsächlich liegt hier zwar ein dominant-rezessiver Erbgang vor, allerdings mit matrokliner Vererbung: Nicht der eigene Genotyp der Schnecke bestimmt die Windungsrichtung ihres Gehäuses, sondern der Genotyp des Muttertiers, genauer der Eizelle, aus der das Schneckenkind hervorgeht.
Da Weinbergschnecken Zwitter sind, ist bei der Vererbung der Schalenrichtung der Genotyp der Eizelle relevant. Das liegt daran, dass Schnecken zu den Spiralia gehören, eine Tiergruppe, bei der sich schon die ersten Zellteilungen der Eizelle spiralig anordnen und so die spätere Drehrichtung der Schale vorgeben. Die genetische Information hierfür sitzt im Zellplasma der Eizelle.
Wenn zwei Schneckenkönige (also links gewundene Weinbergschnecken) Nachkommen zeugen, sollten diese nach den klassischen Regeln alle links gewunden sein. Doch aufgrund der matroklinen Vererbung kann es dennoch vorkommen, dass der Nachwuchs plötzlich rechts gewunden ist, je nachdem, welche Eizelle und welcher Genotyp vorliegen.
Was auf den ersten Blick eine einfache Laune der Natur zu sein scheint, ist in Wirklichkeit ein spannendes Beispiel für komplexe Vererbungsmuster und die faszinierende Welt der Genetik.
Literatur
- https://de.wikipedia.org/wiki/Schneckenkönig
- https://www.weichtiere.at/Schnecken/land.html?/Schnecken/land/windung.html
- https://www.weichtiere.at/Schnecken/land.html?/Schnecken/land/kreuzung.html
- Abbildung 2: https://de.wikipedia.org/wiki/Schneckenkönig#/media/Datei:Helix_aspersa_Sinistra_MHNT.CON.2002.767.768.jpg