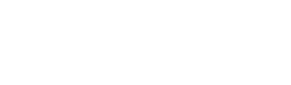Drehtisch
Ein Kind lernt Fahrradfahren – anfangs wacklig, doch sobald es schneller wird, bleibt das Rad plötzlich stabil. Aber warum eigentlich? Wenn du mit dem Fahrrad fährst, balancierst du nicht ständig aktiv wie auf einem Schwebebalken. Stattdessen sorgt die Bewegung selbst für Stabilität. Es ist fast so, als würde das Fahrrad „von selbst“ aufrecht bleiben, solange es in Fahrt ist.
Dieses alltägliche Phänomen hat eine tiefe physikalische Ursache: Bewegung, genauer gesagt Rotation, erzeugt Stabilität. Und genau dieses Prinzip kannst du mit dem Drehtisch-Exponat selbst erleben, ohne Sattel, aber mit einer drehenden Scheibe und einem Ring.