SigMath
Am Infopoint kannst du es dir auf gemütlichen Bänken bequem machen und in Sachbüchern und spannenden Vertiefungstexten stöbern. Ein Monitor bietet direkten Zugriff auf unsere Website mit allen weiterführenden Inhalten. Außerdem findest du einen zweiten Monitor, auf dem du das Spiel „SigMath“ starten kannst: Hier stellst du dich in verschiedenen Schwierigkeitsstufen kniffligen Fragen aus den vier großen Teilgebieten der Mathematik – Analysis, Algebra, Geometrie und Stochastik. Egal ob Buch oder Bildschirm, alles ist da, um Mathematik zu entdecken.
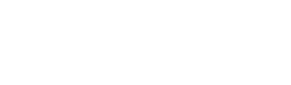

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ \int_a^b f(x)\, dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i. \]](https://erlebnisland-mathematik.de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c40d4ef0d3065a3661b2b2a91825ef5e_l3.png)
![Rendered by QuickLaTeX.com \[ \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i \]](https://erlebnisland-mathematik.de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d01f8e02a7d235085344fe6eb9abe757_l3.png)